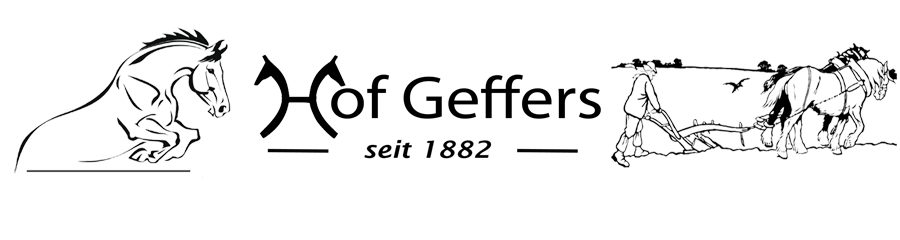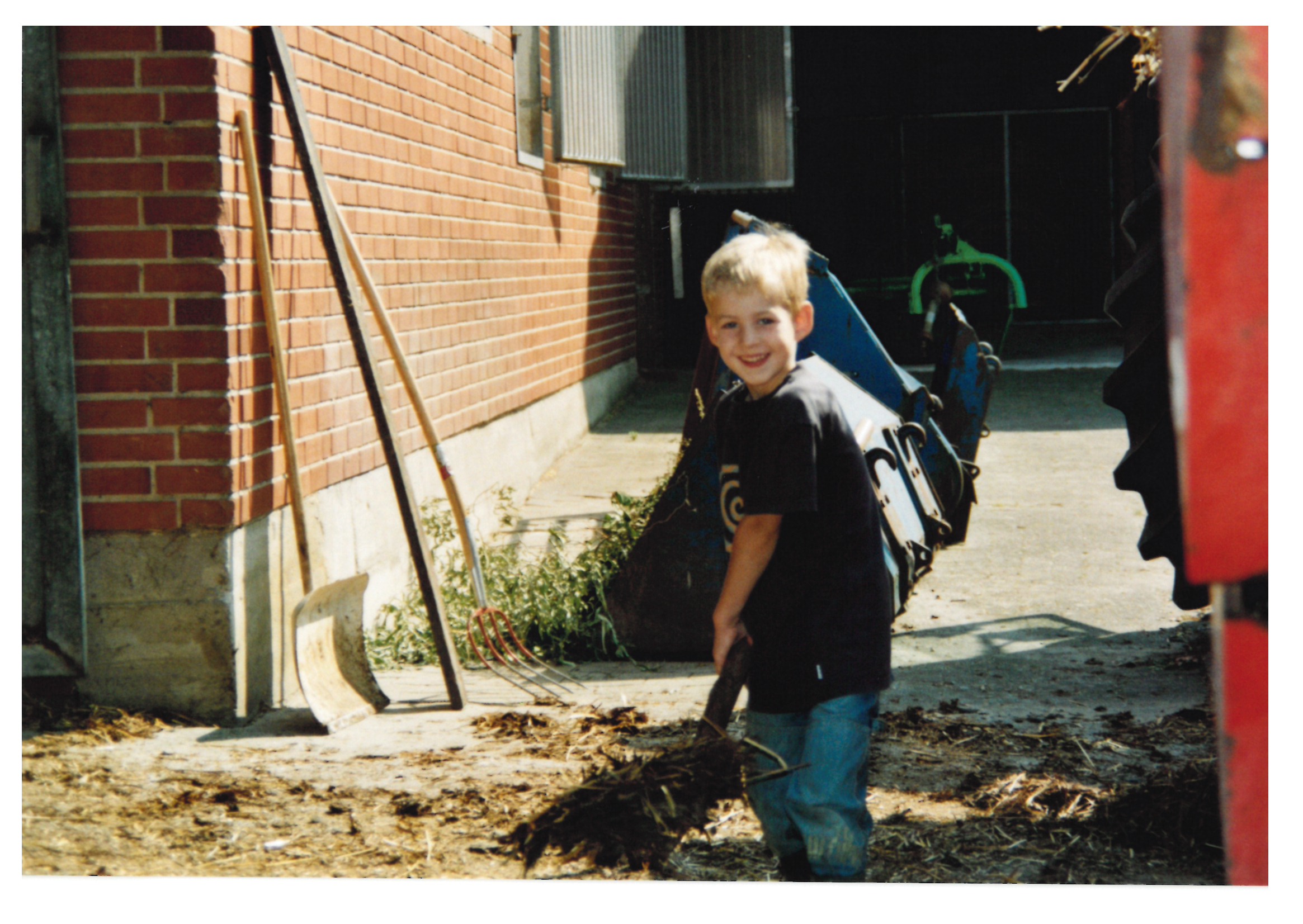Klimaresilienz
Klimaresilienz in der Landwirtschaft bedeutet, die Widerstandsfähigkeit von Agrarbetrieben gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu stärken. Dies umfasst Maßnahmen wie die Einführung vielfältiger Fruchtfolgen, den Anbau resistenter Pflanzensorten und den Einsatz effizienter Bewässerungssysteme. Durch den Zwischenfruchtanbau wird die Bodenqualität verbessert und Erosion vermindert. Zudem tragen nachhaltige Anbaupraktiken und innovative Technologien dazu bei, die Ernteerträge zu stabilisieren und langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Solche Anpassungsstrategien sind entscheidend, um die landwirtschaftliche Produktivität und Ernährungssicherheit in Zeiten zunehmender klimatischer Herausforderungen zu sichern. Wir fühlen uns dieser Verantwortung verpflichtet und leisten oftmals über die Minimalanforderungen hinaus unseren Beitrag.
Förderung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
Im Rahmen des ELER, des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums erhalten wir Förderungen zur Verbesserung der Bodenqualität sowie zur Erhöhung der Artenvielfalt im ländlichen Raum.

Gewässerschutz
Gewässerschutz in der Landwirtschaft ist entscheidend, um die Wasserqualität zu erhalten und Verschmutzungen zu vermeiden. Hier sind einige wichtige Abstandsregelungen und Auflagen, die wir als landwirtschaftliche Betriebe einhalten müssen:
- Gewässerrandstreifen: Es müssen Pufferzonen entlang von Gewässern eingerichtet werden. Diese Randstreifen, die in der Regel mindestens 5 bis 10 Meter breit sind, dürfen nicht landwirtschaftlich genutzt werden, um den Eintrag von Nährstoffen und Pestiziden in die Gewässer zu verhindern.
- Düngemittel und Pflanzenschutzmittel: Die Ausbringung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln ist in der Nähe von Gewässern streng reglementiert. Es müssen Mindestabstände eingehalten werden, um den direkten Eintrag in Gewässer zu vermeiden. Diese Abstände können je nach Art der Chemikalien und lokalen Vorschriften variieren, betragen aber meist mindestens 3 bis 10 Meter.
Düngeverordnung
Die Düngeverordnung (DüV) zielt darauf ab, die Umwelt vor schädlichen Nährstoffeinträgen zu schützen und die Wasserqualität zu verbessern, insbesondere durch die Reduzierung von Nitrat- und Phosphatgehalten im Grund- und Oberflächenwasser. Um diese Ziele zu erreichen, legt die DüV verschiedene Auflagen für die Landwirtschaft fest, darunter genaue Vorgaben zur Nährstoffbilanzierung, zeitliche und mengenmäßige Beschränkungen der Düngerausbringung, verpflichtende Bodenuntersuchungen und Aufzeichnungspflichten. Diese Maßnahmen sollen eine umweltgerechte und effiziente Nährstoffnutzung gewährleisten und die Belastung der Gewässer minimieren.
Rote Gebiete
Die "roten Gebiete" sind Gebiete, die gemäß der Düngeverordnung als besonders belastet mit Nitrat eingestuft werden. In diesen Gebieten gelten strengere Auflagen für die Landwirtschaft, einschließlich verschärfter Düngeregeln und zusätzlicher Maßnahmen zur Reduzierung der Nitratbelastung im Grundwasser. Die Auflagen in den "roten Gebieten" gemäß der Düngeverordnung umfassen:
- Düngungsmengenbegrenzung: Es gelten strengere Grenzwerte für die maximal zulässige Düngemenge pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche, um eine Überdüngung zu vermeiden.
- Nährstoffbilanzierung: Landwirte müssen eine detaillierte Nährstoffbilanz führen, die den Eintrag und die Ausbringung von Stickstoff und Phosphor dokumentiert. Dies dient der Überwachung und Kontrolle der Nährstoffverluste.
- Sperrfristen: Es gibt festgelegte Zeiträume, während derer die Düngung aufgrund der Witterungsbedingungen und zur Vermeidung von Nährstoffauswaschungen ausgesetzt ist (z.B. Wintermonate).
- Verbot der Düngung in bestimmten Schutzgebieten: In empfindlichen Gebieten wie Wasserschutzgebieten oder Überschwemmungsgebieten sind bestimmte Düngemaßnahmen ganz oder teilweise verboten.
- Pflicht zur Bodenuntersuchung: Regelmäßige Bodenuntersuchungen sind obligatorisch, um den Nährstoffgehalt im Boden zu überwachen und die Düngung entsprechend anzupassen.
Integrierter Pflanzenschutz
Der integrierte Pflanzenschutz ist eine umfassende Strategie zur effektiven Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, Schädlingen und Unkräutern. Er vereint präventive Maßnahmen wie die Nutzung resistenter Sorten und Fruchtfolgen mit gezielten Anwendungen von chemischen, biologischen und kulturellen Bekämpfungsverfahren. Ziel ist es, Umweltbelastungen zu minimieren und gleichzeitig nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Lösungen im Pflanzenschutz zu fördern.
Kreislaufwirtschaft
Die landwirtschaftliche Kreislaufwirtschaft ist ein Konzept, das darauf beruht, alle Prozesse und Ressourcen innerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebs möglichst effizient zu nutzen und dabei einen geschlossenen Kreislauf zu schaffen. Dies beinhaltet die Wiederverwertung von organischen Materialien wie Ernteresten und Tierexkrementen durch Kompostierung und Mulchen. Ziel ist es, diese Ressourcen als natürlichen Dünger zurück in den Boden zu bringen, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu verbessern. Durch die Integration von Pflanzen- und Tierproduktion in einem synergistischen System wird nicht nur die Abfallmenge reduziert, sondern auch die Abhängigkeit von externen Inputs wie chemischen Düngemitteln und Pestiziden verringert. Dies trägt zur Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Praktiken bei, indem es ökologische Auswirkungen minimiert und langfristig die Produktivität und Gesundheit des Agrarsystems fördert.